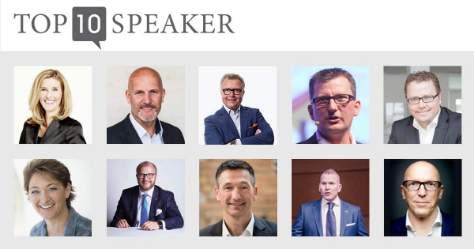In ihrer Reportage „Charlottesville: Race and Terror“ begleitete VICE News Tonight-Korrespondentin Ellen Reeve vergangenes Wochenende den rechtsradikalen Alt-Right-Radiomoderator – und Sprecher, Christopher Cantwell. Wir sehen in dem Videomaterial unter anderem drei Kurzinterviews mit ihm. Das erste Interview fand während einer Versammlung der Alt-Right-Mitglieder am Freitagmittag statt, einige Stunden bevor sie zu hunderten mit Fackeln durch die Stadt zogen. Das kürzeste wurde eine halbe Stunde vor offiziellem Beginn der „Vereint die Rechte“-Demo am Samstagmorgen aufgenommen, wobei Cantwell auch hier wieder umringt ist von seinen Kameraden – diesmal in einer deutlich angespannteren Konstellation. Das letzte Interview zeigt den Rechtsextremisten schließlich in einem Hotelzimmer in North Carolina, einen Tag nach der eskalierten Demo, bei der drei Menschen ihr Leben verloren. Vor dem Hintergrund der drei unterschiedlichen Szenarien ist es daher umso wichtiger, am Beispiel Cantwells die rhetorischen Strategien von Rechtsradikalen zu enttarnen.
Die Ruhe vor dem Sturm
Umringt von seinen Alt-Right-Kameraden steht Cantwell der Reporterin Rede und Antwort – mehr oder weniger. Es zeigt sich schnell, dass er offen gestellten Fragen, die man nicht nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten muss, gegenüber unsicher ist. Wir erkennen das auf sprachlicher Ebene vordergründig an Generalisierungen, Beleidigungen und Ausweichtaktiken: Da in den Jahren 2012 und 2014 nach gerichtlicher Auffassung rechtmäßig drei afroamerikanische Kinder bzw. Jugendliche von Polizisten erschossen wurden, sei belegt, dass die weiße Bevölkerung generell nicht zu einem solch primitiven Verhalten neige, wie es die „schwarzen Arschlöcher“ täten. Wie solch primitives Verhalten allerdings aussieht, führt er nicht weiter aus. Cantwell befindet sich zu dem Zeitpunkt des Interviews noch in der Defensive und verhält sich auch dementsprechend.
Er hält kaum Blickkontakt, ist sichtlich nervös und unsicher, denn seine Finger bewegen sich unkontrolliert und er verschränkt die Arme vor der Brust. Als er von der Reporterin mit diversen Beispielen von durch Weiße verübte Straftaten konfrontiert wird, nutzt er die Gelegenheit zur Offensive und reagiert einfach mit provokativen Gegenfragen, die sie natürlich nicht beantworten kann. Mit der Übernahme der Gesprächsführung gewinnt er an Selbstsicherheit und strahlt dies nicht nur durch Handbewegungen, intensiven Blickkontakt und einen vorgebeugten Oberkörper aus – auch inhaltlich wird er mutiger.
Menschenverachtendes Vokabular
Cantwell erklärt ganz offen, dass er auf eine höhere Gewaltbereitschaft hintrainiere, um seiner Weltanschauung den nötigen Nachdruck zu verleihen. An seinem kurzen Blick nach unten erkennen wir aber auch die Scham, zu hoch gegriffen zu haben, denn er weiß, wie kriminell sich das anhört. Also schiebt er, ohne dass der Zuschauer das Gesagte verarbeiten kann, das Argument mit der höchsten Autorität hinterher: Präsident Donald Trump als Beispiel dafür, wie man als gestandener Amerikaner mit dem Thema Rassentrennung richtig umzugehen hat – nämlich in keinem Fall die Ehe zwischen der eigenen Tochter und einem Juden zuzulassen. Dabei presst er die Lippen aufeinander und lächelt ertappt – er hat es gerade noch geschafft, sich sein menschenverachtendes Vokabular zu verkneifen.
Selbstbeherrschung fällt ihm jedoch sichtlich schwer, denn keine zehn Sekunden später ergießen sich seine unterdrückten Gedanken dann doch in einem Schwall antisemitischer Beleidigungen. Das Interview endet mit der Äußerung, den Zusammenhalt innerhalb der Alt-Right-Gruppierungen künftig durch „Aktivismus“ zu stärken – eine Wortwahl, die im Nachhinein nahezu grotesk erscheint.
„Wir tun nur, was von uns verlangt wird!“
Kurz vor Beginn der Demo sprach Ellen Reeve ein weiteres Mal mit Cantwell. Der „Aktivist“ schien der Situation entsprechend adrenalingeladen und auch verglichen zum Vortag war keine Spur von Unsicherheit oder Scham zu erkennen. In der Rolle des Alpha-Tieres und als Sprecher für die gesamte rechte Bewegung, adressierte Cantwell diesmal die weiße Bevölkerung direkt durch die Kamera mit einer hochemotionalen Botschaft: Was auch immer Kritiker von ihm hielten – am Ende des Tages seien es die weißen Nationalisten, die selbige Kritiker vor den Gefahren (gemeint sind Afroamerikaner) schützen. Solche Äußerungen sind paradigmatisch für Kriegsrhetorik. Eine gewaltbereite, meist radikale Gruppierung deklariert eine Form von Krieg unter dem Deckmantel der Rechtschaffenheit für das Wohl der Allgemeinheit.
Das dritte und letzte Interview – Bilanz ziehen
Es war der Sonntag nach den gewaltsam eskalierten Ausschreitungen, an dem Ellen Reeve ein letztes Mal Christopher Cantwell interviewte. Neben den drei Toten waren auch Präsident Trumps Äußerungen zu den Vorfällen bereits medial bekannt geworden. Da er keine eindeutigen Schuldzuweisungen in Richtung „rechts“ vorgenommen hatte, ist davon auszugehen, dass sich Cantwell in seiner Auffassung von richtig und falsch zusätzlich von höchster Instanz bestätigt sah – von Reue war jedenfalls weder mimisch noch sprachlich etwas zu sehen. Würden wir die Aufnahmen von Freitag und Sonntag parallel laufen lassen, ließe sich die Entwicklung des Rechtsradikalen eindeutig belegen. Wir sehen nun einen Mann, der zunächst sehr ruhig und gefasst wirkt: Weder verschränkte Arme noch nervösen Zuckungen, dafür steter Augenkontakt.
Die Fassade beginnt in dem Moment zu bröckeln, als die Reporterin auf die zu Tode gekommene Gegendemonstrantin zu sprechen kommt. Cantwell fühlte sich sichtlich unwohl und sendet unterbewusst Fluchtsignale, indem er seinen Kopf hin und her dreht und Reeves Blicken ausweicht. Als er beschreiben sollte, wie er das Video des wegfahrenden Tatfahrzeuges interpretiert, lächelte er. Cantwell gefällt der Gedanke an die tote junge Frau und seine darauffolgende Aussage, der Vorfall sei sehr bedauerlich, ist damit hinfällig. So auch sein Versuch, sich im Kontext eines Todesfalls sprachlich zu mäßigen, indem er die Stärke seiner Kameraden als erstaunlich bezeichnet. Dabei zeigen seine zusammengepressten Lippen mehr als deutlich, dass die gewünschte Ausdrucksweise eine provokantere wäre.
Urwald von Tatsachenverdrehungen
Als er darüber spricht, dass Todesfälle unter der afroamerikanischen Bevölkerung im Zuge der künftigen Auseinandersetzungen dazugehören, klingt das zunächst bloß wie eine Billigung – sein Lächeln aber verrät Freude. Er nutzt die Gelegenheit und es folgt eine Kette vermeintlich kausaler Zusammenhänge, wie sie unlogischer nicht sein könnte. Cantwell nimmt einfach die Begriffe „Gewalt“ und „Afroamerikaner“ aus den vorangegangenen Sätzen und ordnet sie in einem anderen Kontext neu an: Dass Afroamerikaner sich angeblich untereinander umbringen, sei Beleg dafür, dass sie Gewalt wollen und die Alt-Right-Bewegung mit ihren Gewaltexzessen ergo nur der Marktnachfrage gleichkäme.
Es ist zugegebenermaßen schwer, sich durch diesen Urwald von Tatsachenverdrehungen zu kämpfen – im Sinne der Wahrheit aber unumgänglich. Cantwell versucht uns mit vermeintlicher Seriosität und leeren Argumenten rhetorisch zu beeindrucken. Wie es tatsächlich in seinem Kopf aussieht, zeigt sich durch den Vergleich „Mimik-Gesagtes“ sehr schnell. Ein Blick sagt wie immer mehr als tausend Worte.